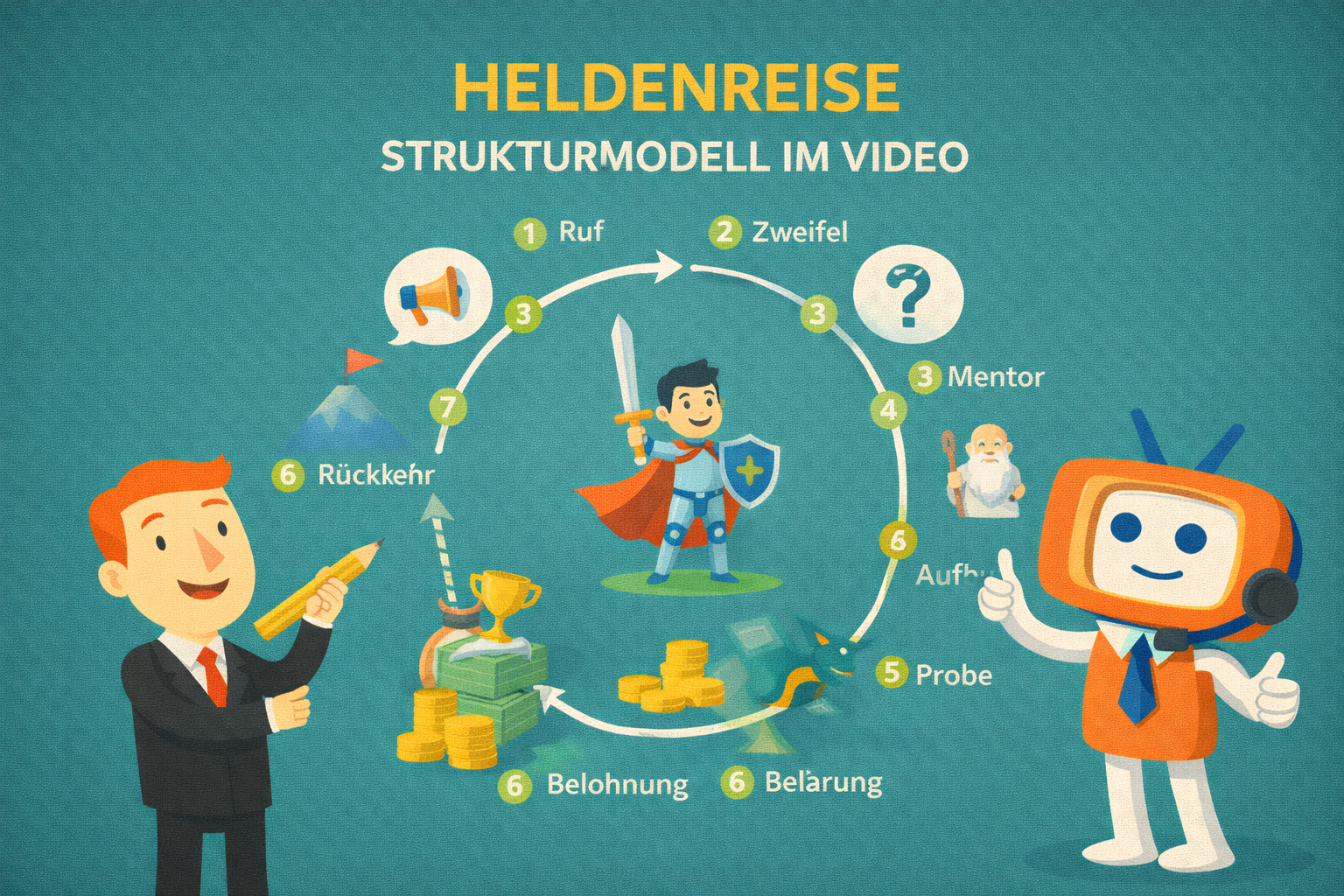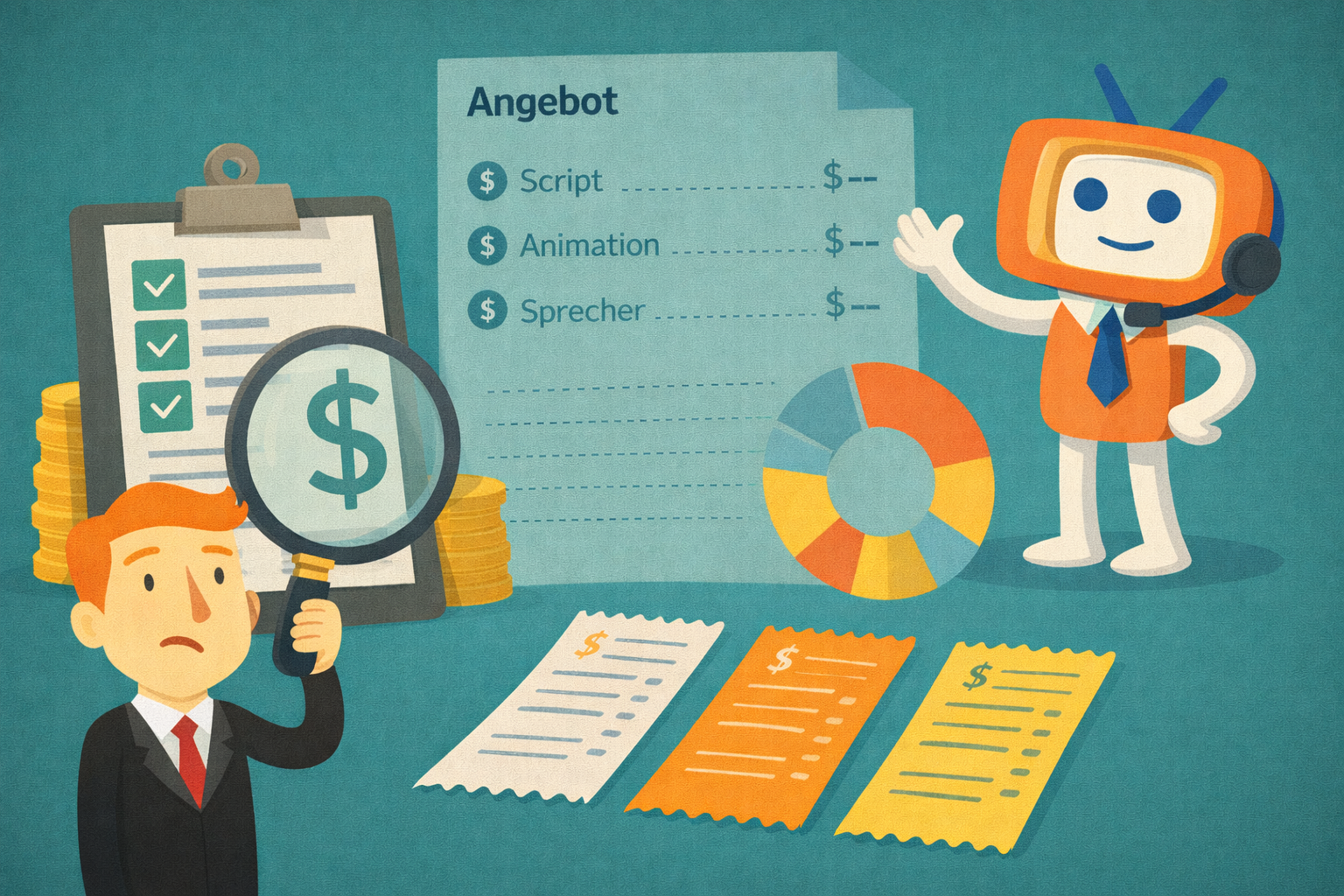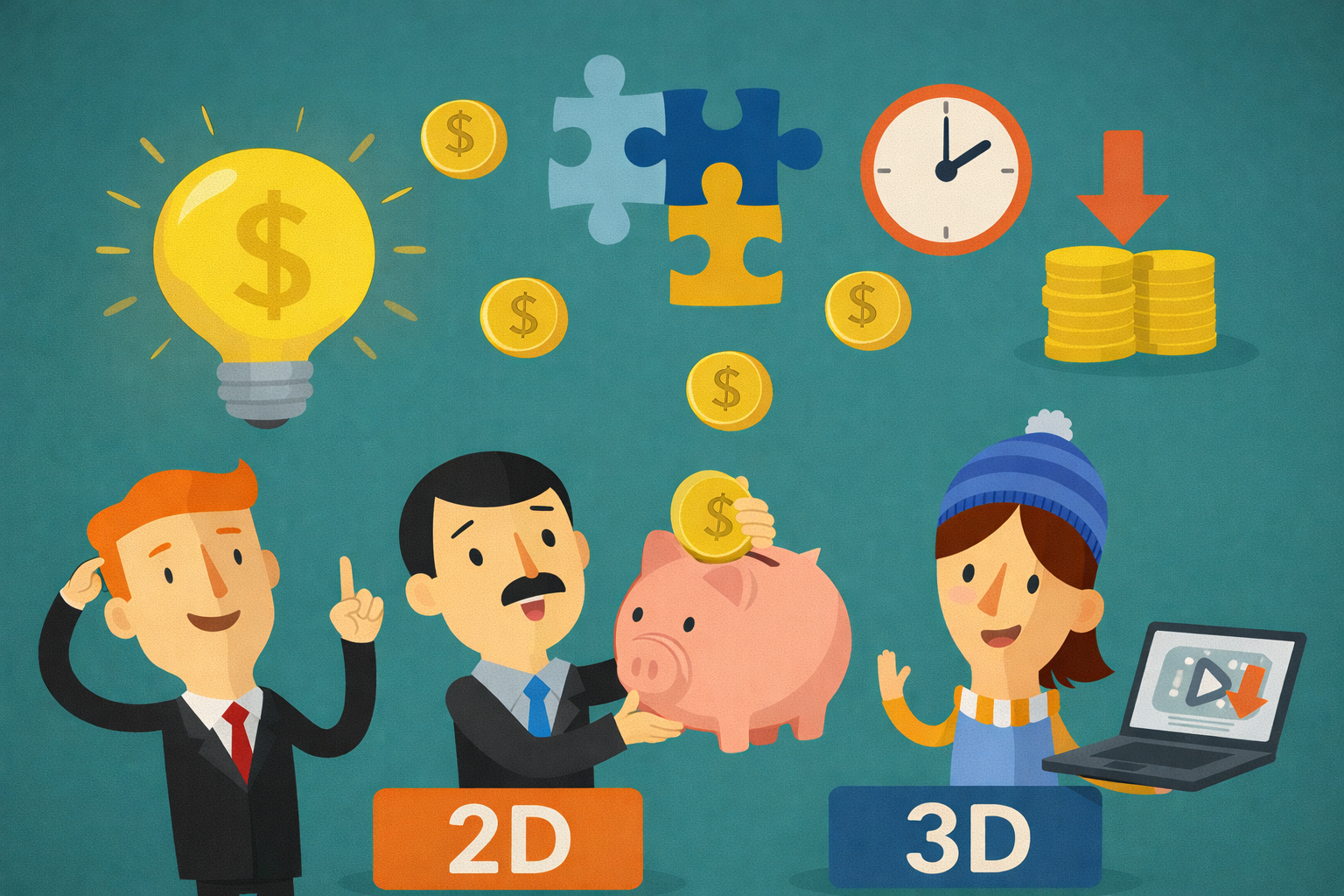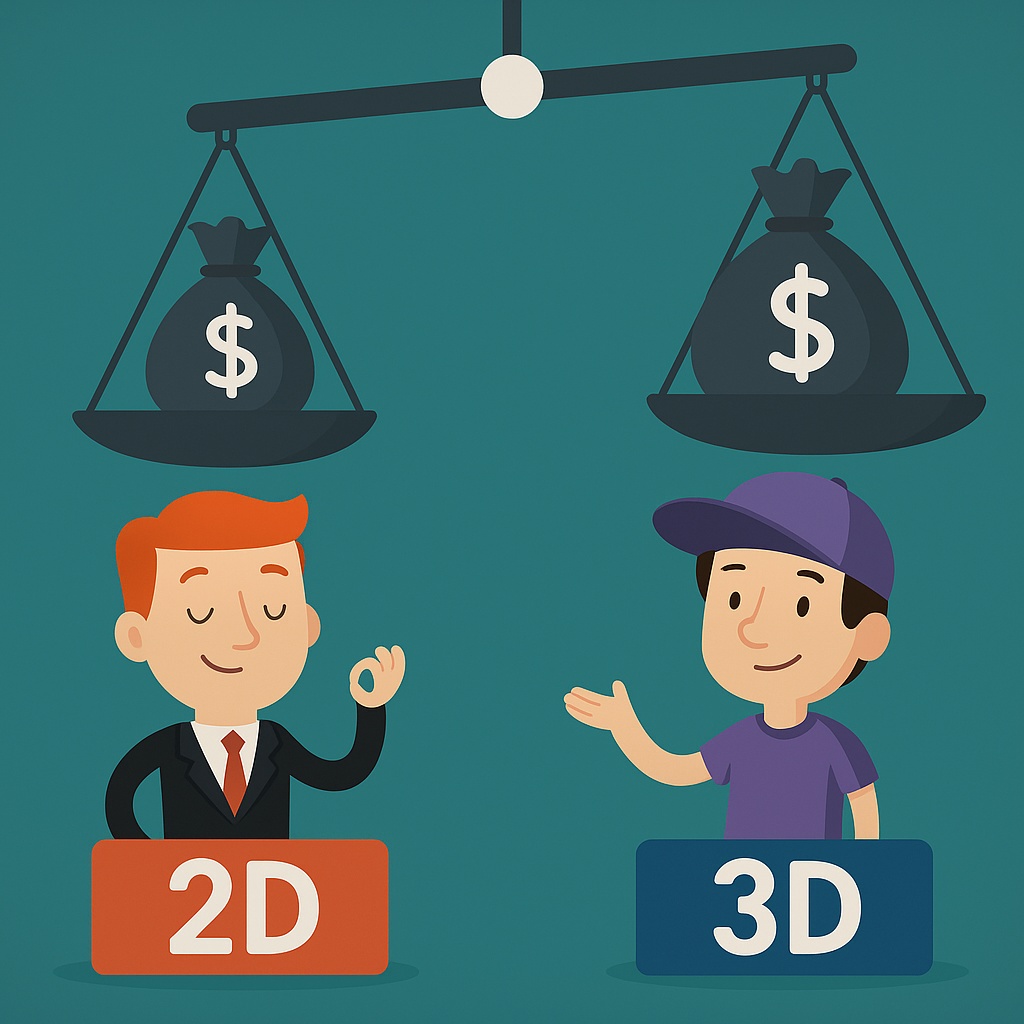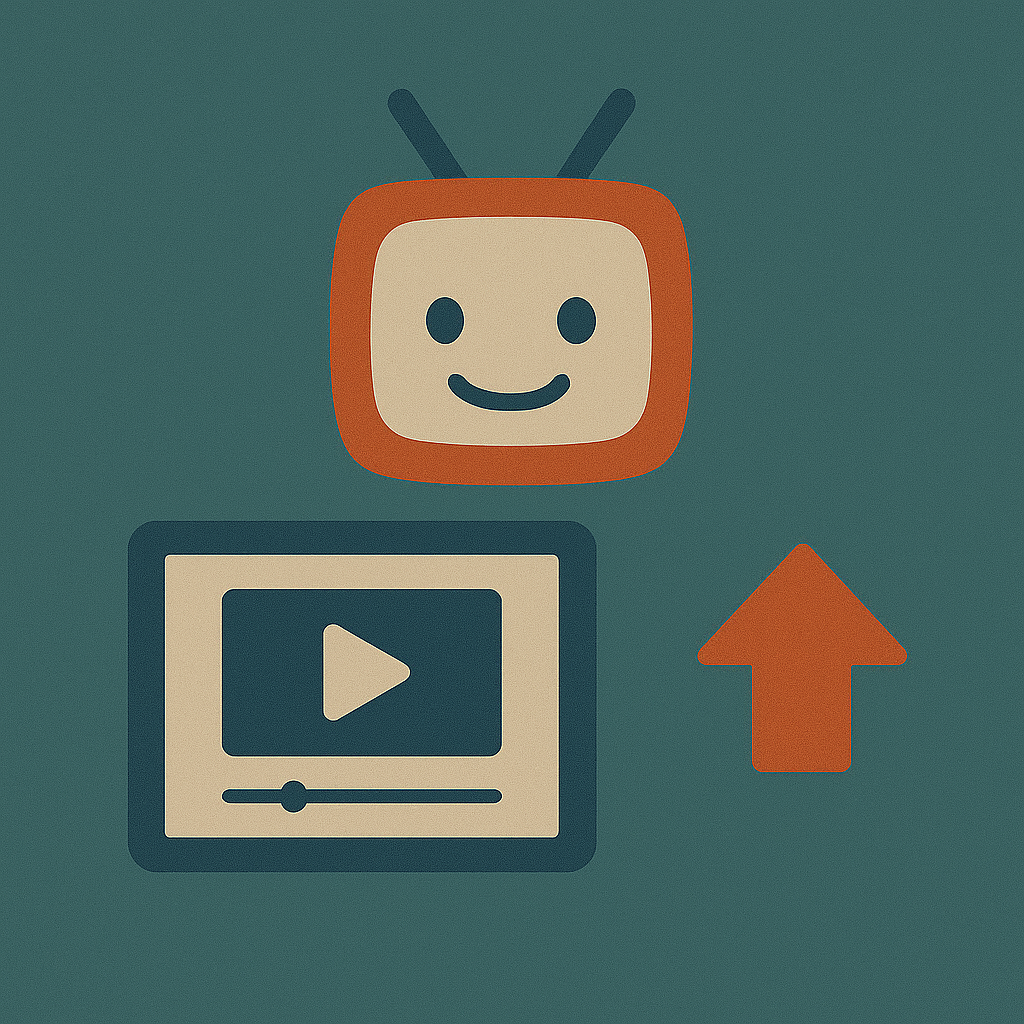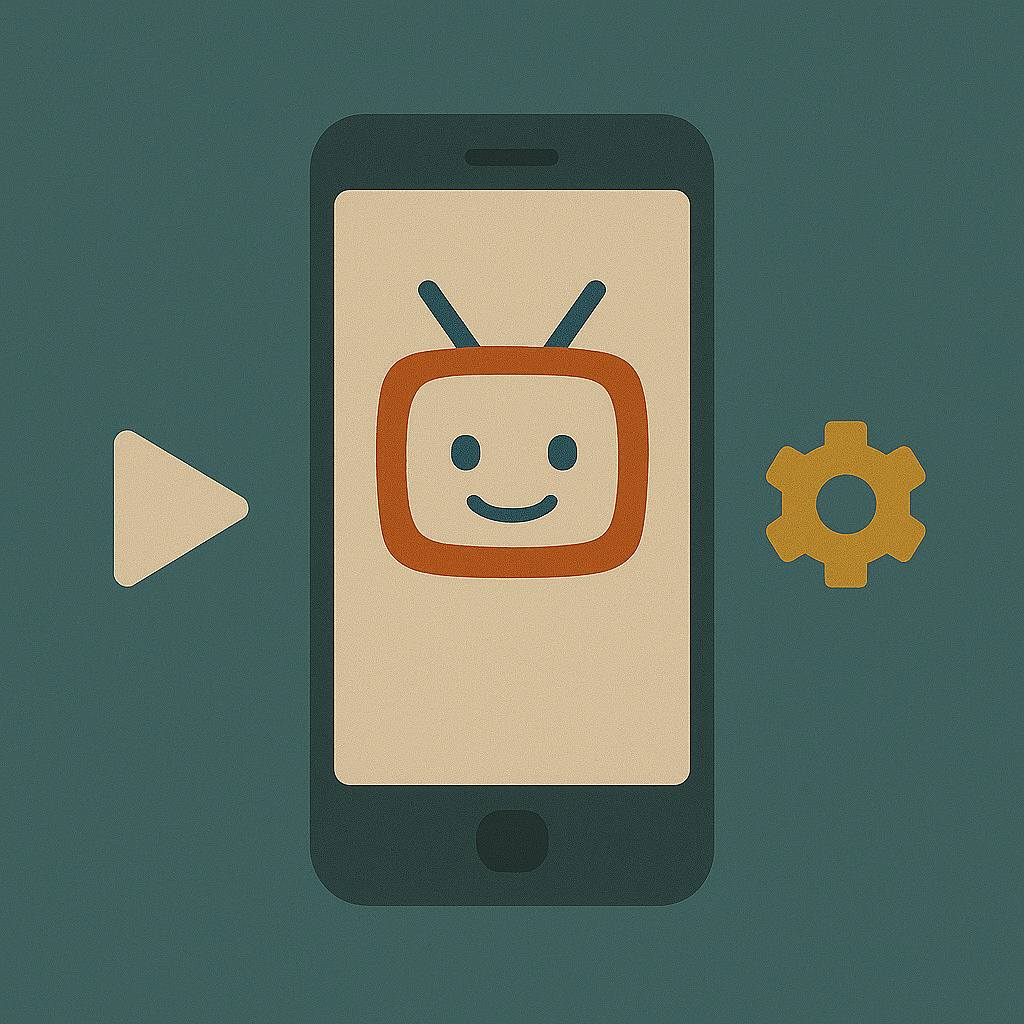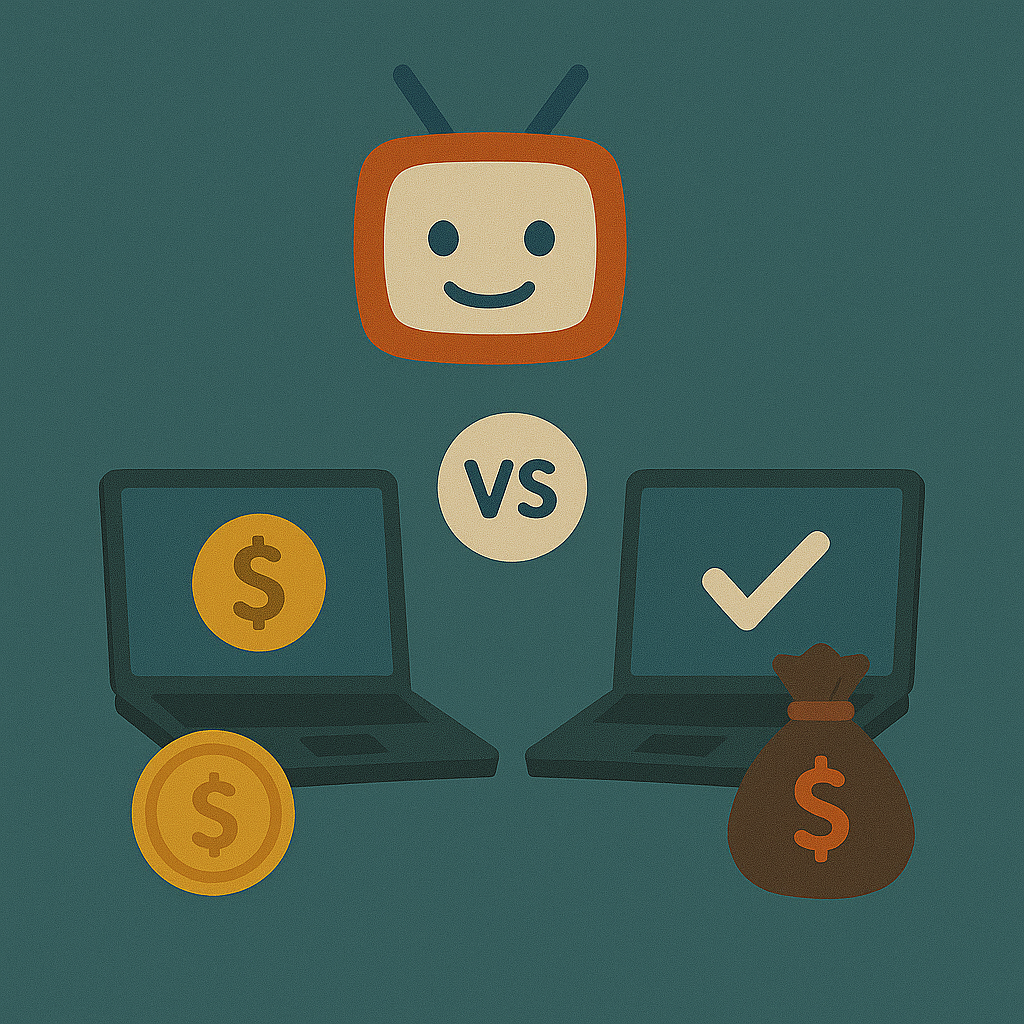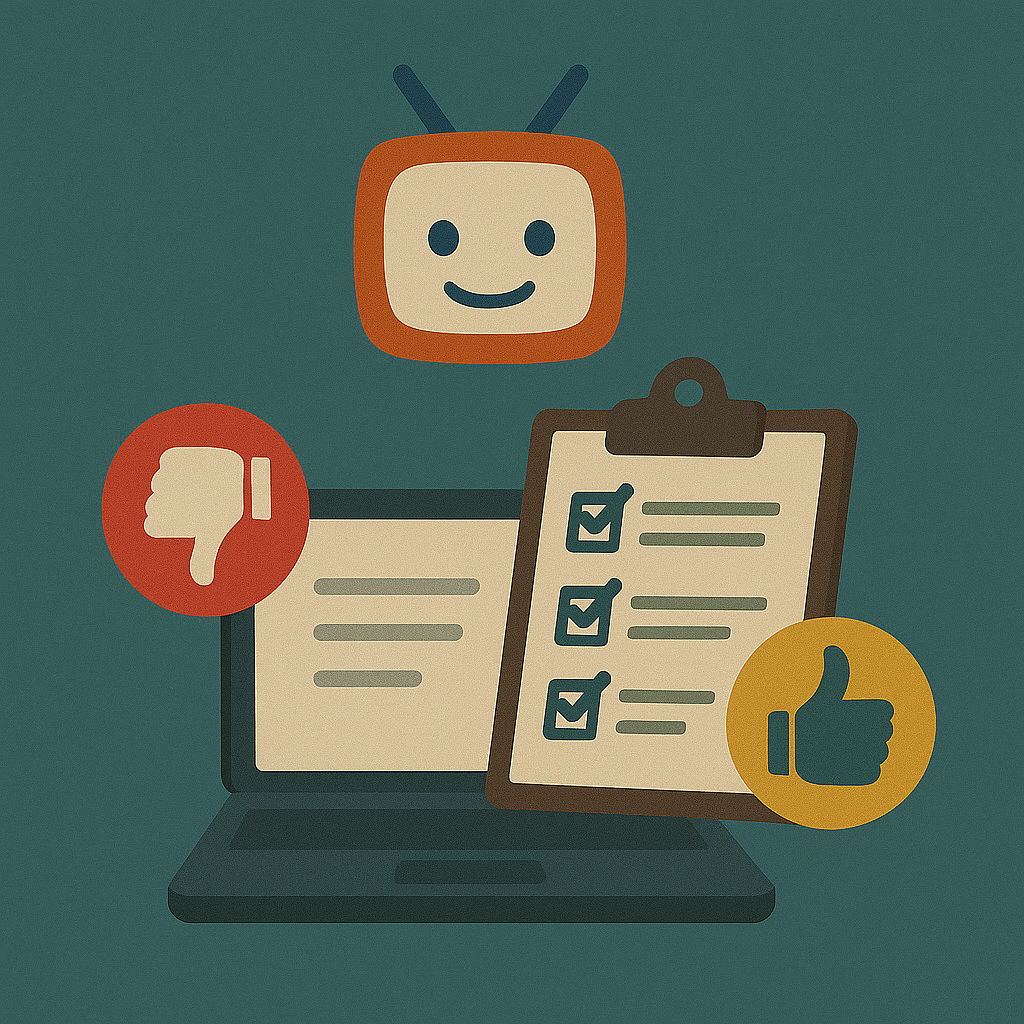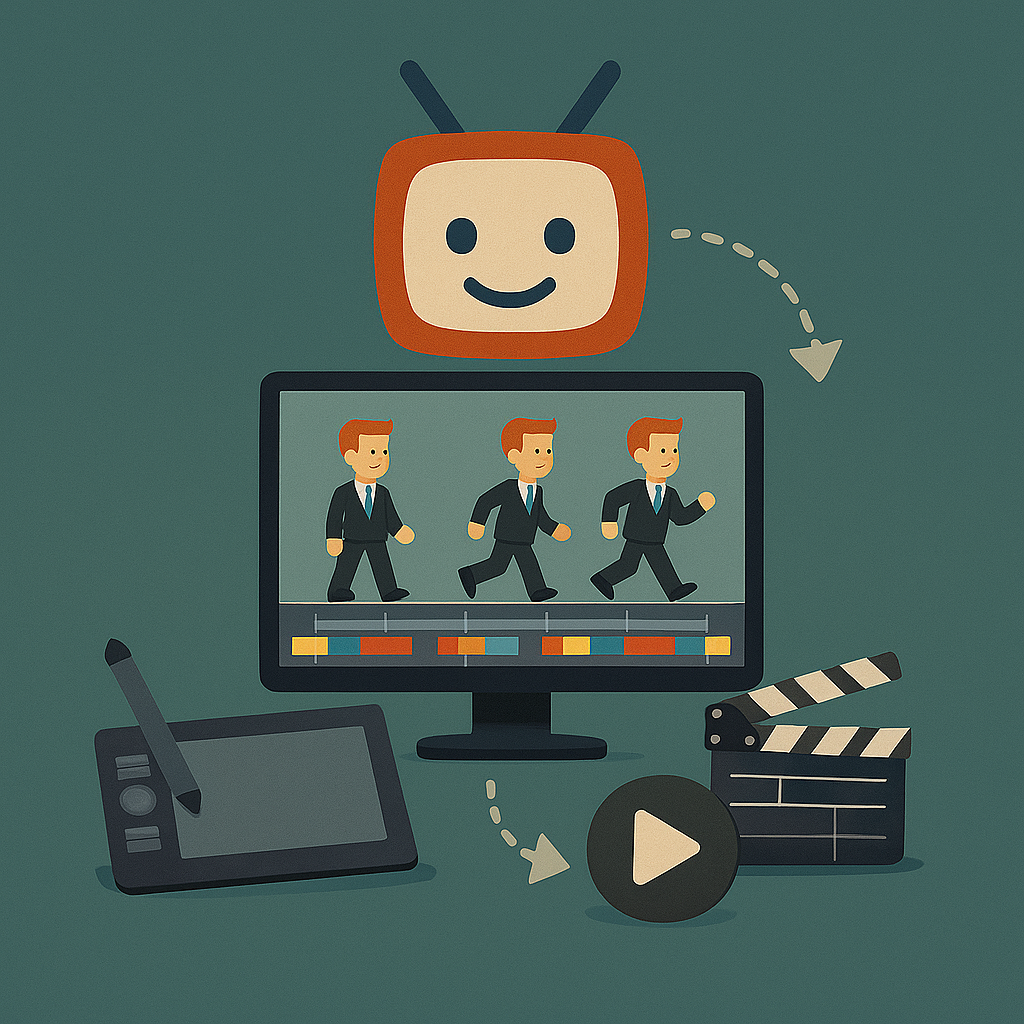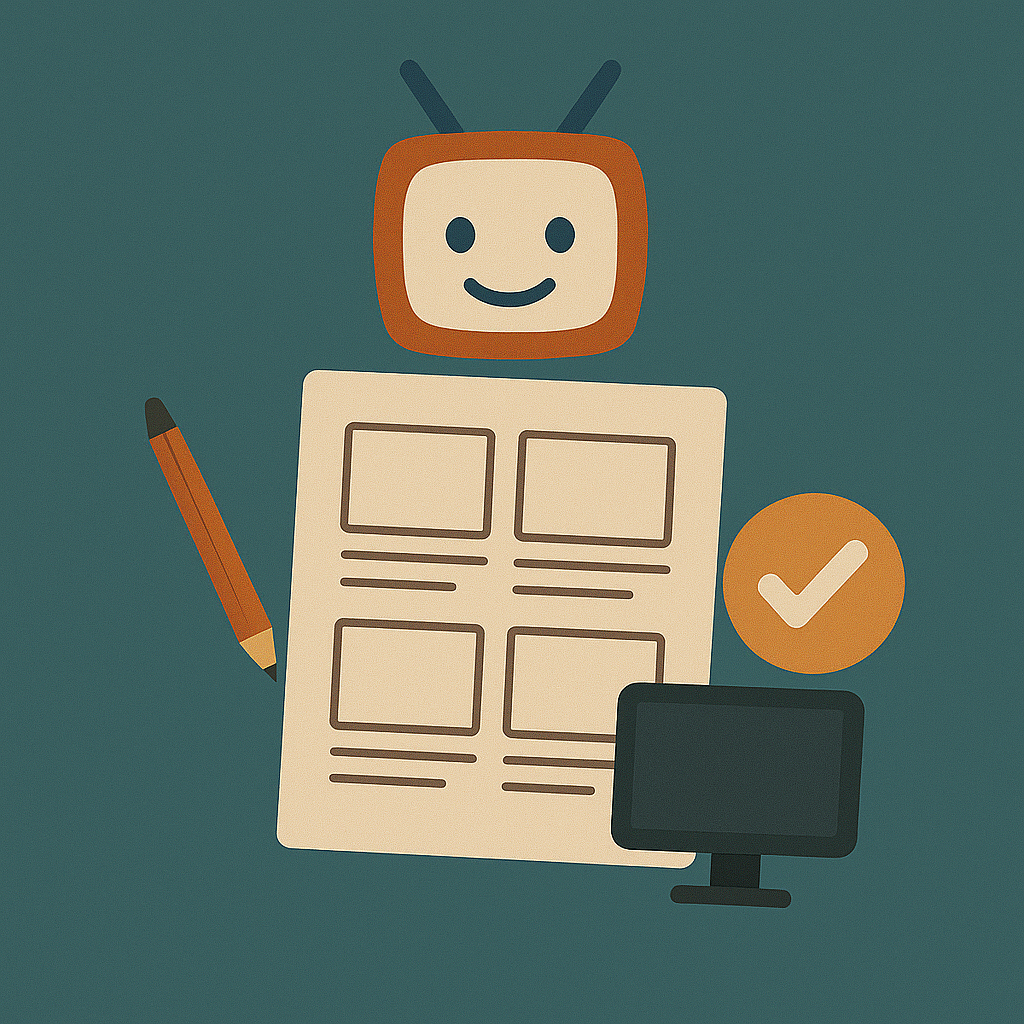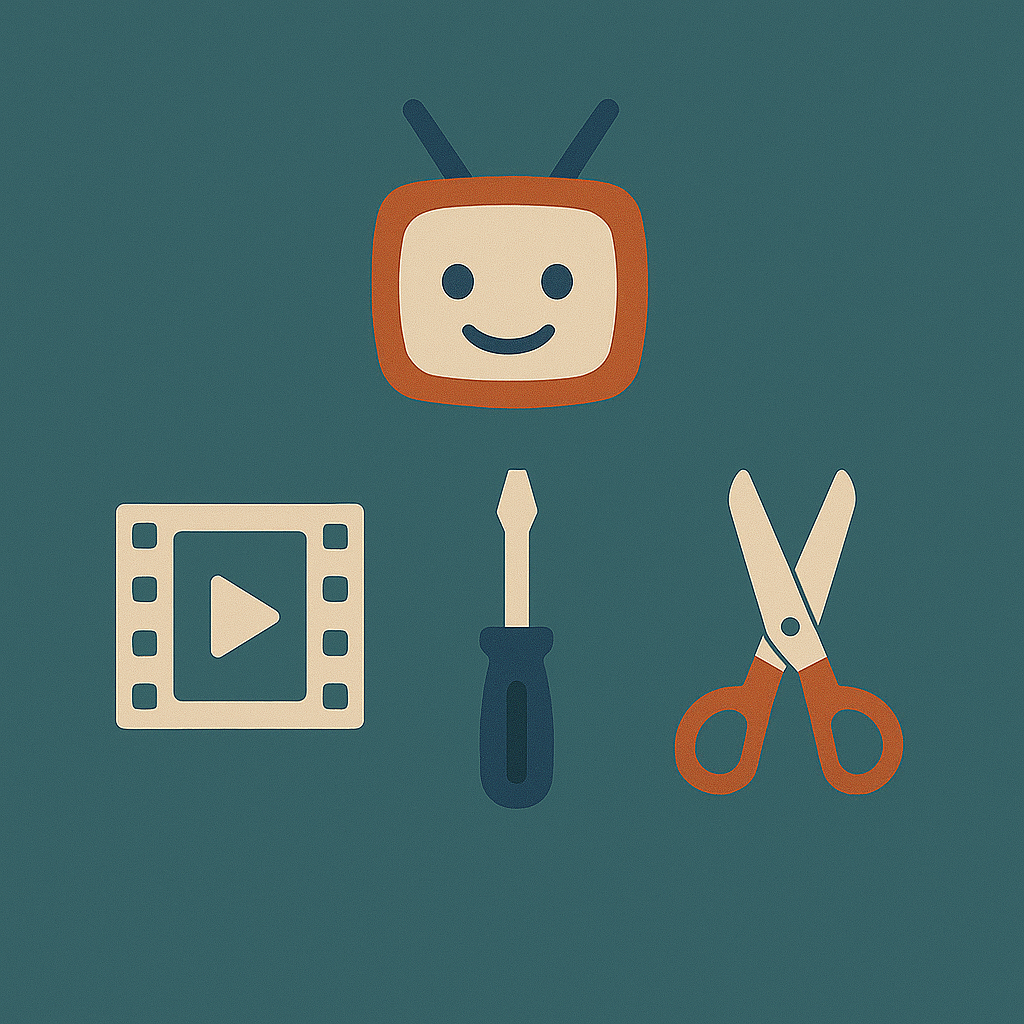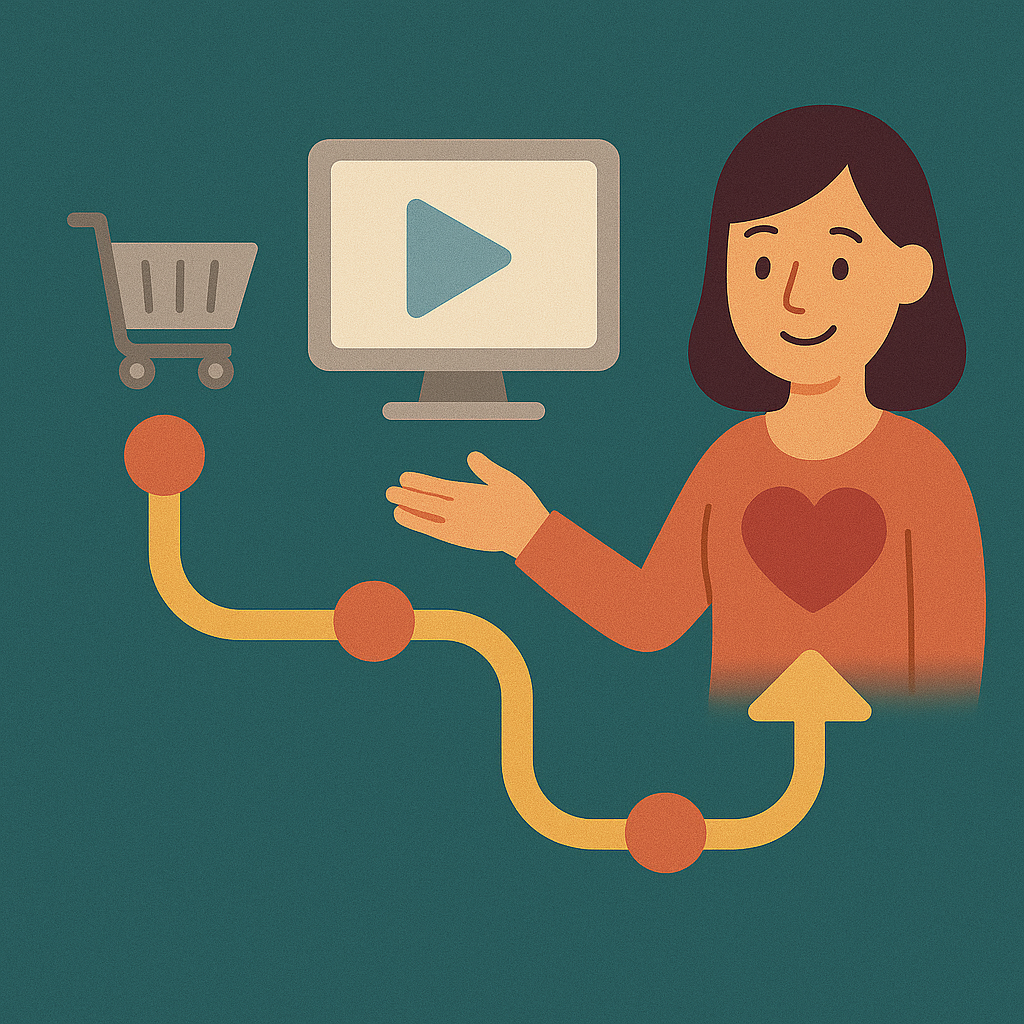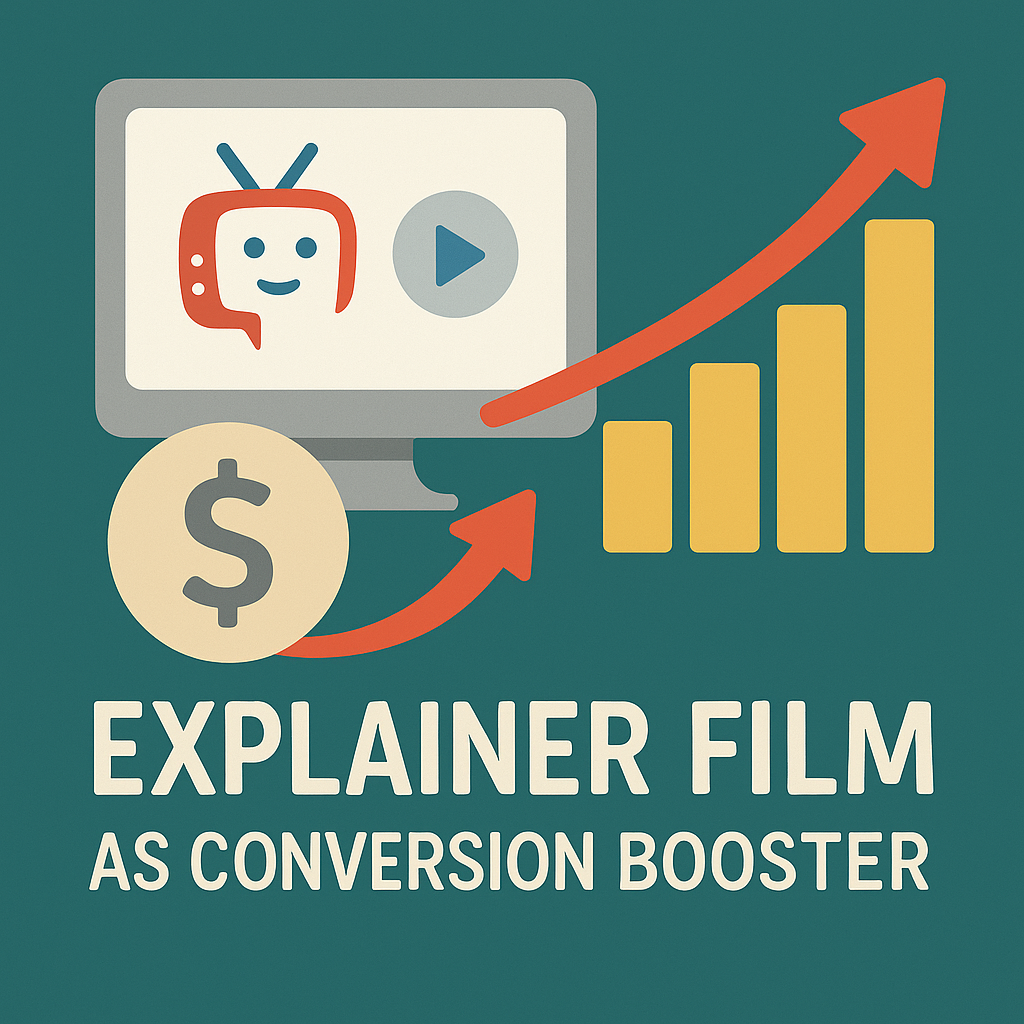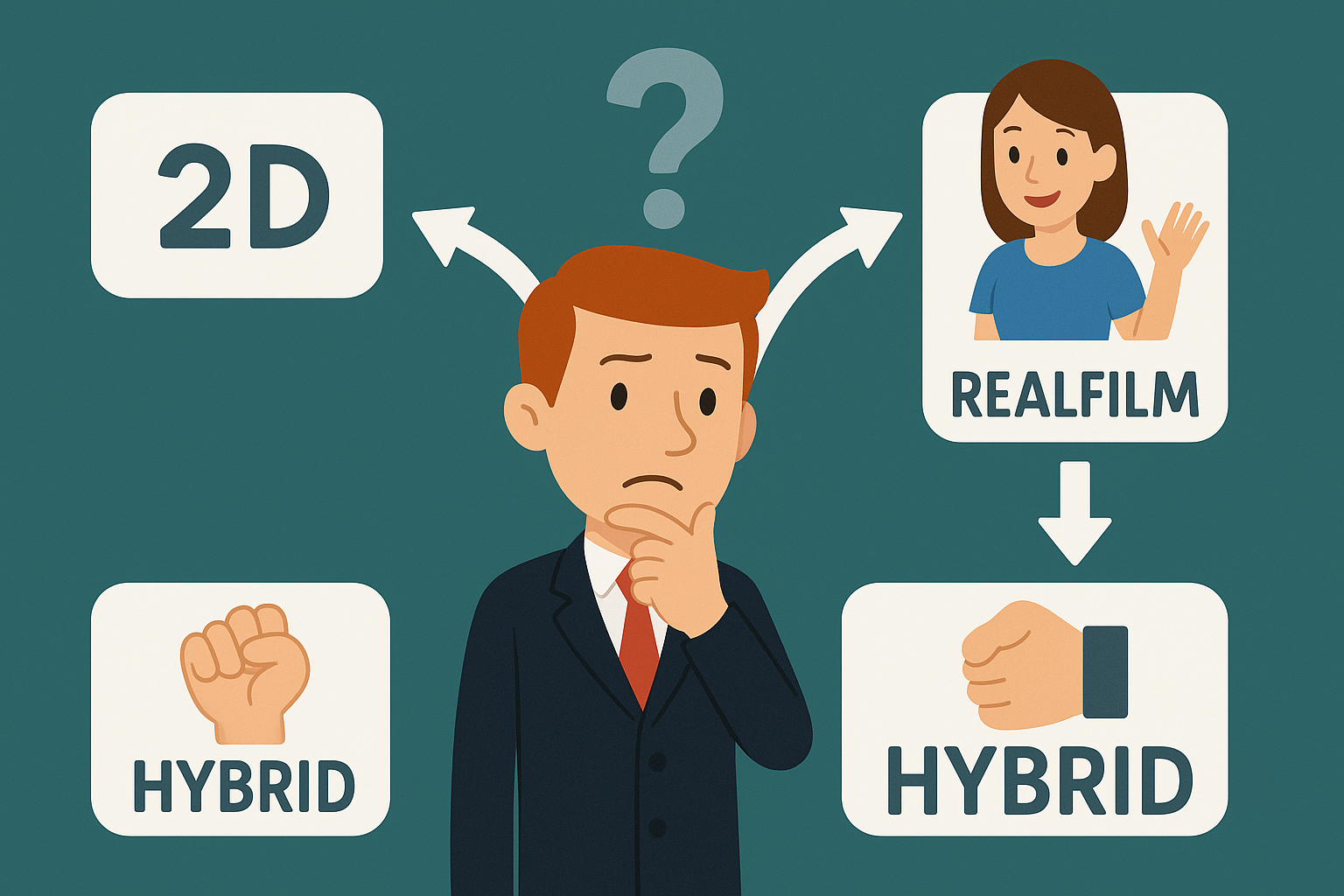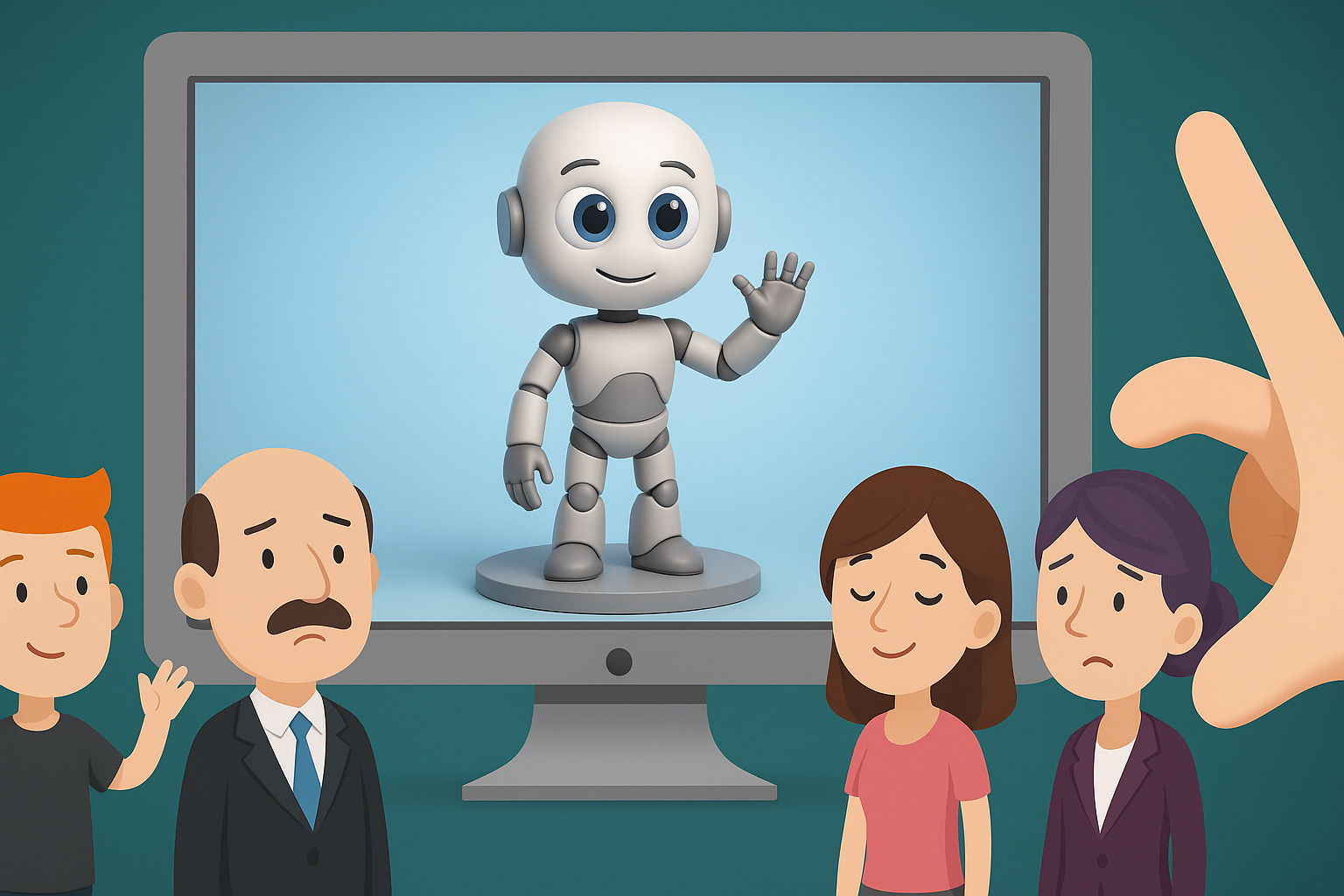Ein weißes Blatt. Ein blinkender Cursor. Und die Frage: Wo anfangen? Wer zum ersten Mal ein Skript für einen Erklärfilm schreibt, steht vor einer paradoxen Situation – es geht um Vereinfachung, aber der Weg dorthin fühlt sich komplex an. Das Problem ist nicht das fehlende Wissen über das Produkt oder die Dienstleistung. Es ist die Verdichtung. Die Übersetzung von allem, was man sagen könnte, in das, was gesagt werden muss. In 60 bis 90 Sekunden. Mit Bildern, die tragen. Mit Worten, die nicht erklären, sondern zeigen.
Warum Skripte scheitern, bevor sie enden
Die meisten Erklärfilm-Skripte kollabieren nicht am Anfang. Sie brechen in der Mitte ein. Der Einstieg ist stark – ein Problem wird skizziert, Spannung entsteht. Dann kommt der zweite Akt, und mit ihm eine Flut an Details, Funktionen, Vorteilen. Der Fokus löst sich auf. Was als klare Linie begann, wird zur Aufzählung. Das Skript verliert Tempo, der Film verliert Zuschauer. Der Grund: Fehlende dramaturgische Disziplin. Ein gutes Skript ist keine Produktbeschreibung in Prosa. Es ist eine Struktur, die Erwartung und Auflösung choreografiert – wie ein Musikstück, das mit einem Motiv beginnt und es durch Variationen trägt, ohne es zu überladen.
Die Architektur eines tragfähigen Skripts
Jede Geschichte braucht ein Gerüst. Für Erklärfilme hat sich eine dreiteilige Struktur bewährt, die weniger Schema als Orientierung ist: Problem, Lösung, Ergebnis. Doch diese drei Blöcke sind keine starren Container. Sie sind Phasen, die ineinander fließen. Der Einstieg muss die Zielgruppe dort abholen, wo sie steht – nicht mit abstrakten Behauptungen, sondern mit einer konkreten Situation. „Jeden Monat gehen Ihnen Aufträge verloren, weil Ihr Angebot zu spät kommt" ist präziser als „Effizienz ist wichtig". Die 5-Schritte-Methode zur strukturierten Skripterstellung zeigt, wie diese Phasen durch klare Übergänge verbunden werden, sodass keine Szene isoliert wirkt.
Verdichtung als dramaturgische Kernaufgabe
Ein typischer Sprecher artikuliert etwa 130 bis 150 Wörter pro Minute. Bei 90 Sekunden bleiben rund 200 Wörter. Das ist weniger als eine halbe A4-Seite. Jeder Satz muss funktionieren. Füllwörter, Relativsätze, Passivkonstruktionen – all das kostet Zeit, die nicht da ist. Die Kunst liegt darin, Komplexität nicht zu verschweigen, sondern zu komprimieren. Statt „Unsere Software ermöglicht es Ihnen, durch automatisierte Prozesse Zeit zu sparen" reicht: „Automatisierung spart Zeit." Der Rest wird visuell erzählt. Wer unsicher ist, ob ein Satz überlebt, liest ihn laut. Was holprig klingt, fällt weg. Was fließt, bleibt.
Bilder denken, bevor Worte kommen
Ein häufiger Fehler: Das Skript wird geschrieben, als wäre es ein Radiobeitrag. Aber Erklärfilme sind visuelle Medien. Die Frage ist nicht nur „Was sage ich?", sondern „Was zeige ich?". Ein Satz wie „Unser Produkt ist flexibel einsetzbar" ist abstrakt. Die visuelle Übersetzung könnte sein: Eine Hand, die ein Modul aus einem System nimmt und an anderer Stelle einsetzt. Das Bild erzählt die Flexibilität, die Sprache bleibt Begleitung. Wer von Anfang an in Szenen denkt, schreibt anders. Jeder Absatz im Skript entspricht einer Einstellung. Jede Information braucht ein visuelles Äquivalent. Diese Doppelstrategie – verbal und visuell – ist das, was Storytelling im Erklärfilm von reiner Information unterscheidet.
Die Sprache der Zielgruppe sprechen
Fachsprache hat ihre Berechtigung – in Fachkreisen. Ein Erklärfilm richtet sich aber meist an Menschen, die das Thema nicht täglich bearbeiten. Wer für ein B2B-Publikum schreibt, darf voraussetzen, dass Begriffe wie „Skalierbarkeit" oder „Integration" verstanden werden. Wer Endkunden anspricht, sollte sie vermeiden oder sofort übersetzen. Die Tonalität folgt der Zielgruppe. Ein Fintech-Start-up kann direkter, fast lakonisch formulieren. Ein Pflegedienstleister braucht Wärme, ohne kitschig zu werden. Die Entscheidung für einen Ton ist keine Geschmacksfrage, sondern eine strategische Weichenstellung. Sie prägt jede Formulierung, jeden Übergang, jede Pause. Und sie sollte bewusst getroffen werden – idealerweise, bevor das erste Wort geschrieben wird.
Der rote Faden: Wiederholung ohne Redundanz
Ein gutes Skript wiederholt, ohne zu langweilen. Es greift ein Motiv auf, variiert es, bringt es zurück. Beispiel: Ein Erklärfilm für ein CRM-System könnte mit der Frage beginnen: „Wie viele Kundendaten gehen täglich verloren?" In der Mitte taucht das Motiv wieder auf: „Keine verlorenen Kontakte mehr." Am Ende wird es aufgelöst: „Jeder Datenpunkt zählt." Diese thematische Klammer schafft Kohärenz. Sie gibt dem Zuschauer das Gefühl, einer Linie zu folgen, nicht einer Aneinanderreihung. Techniken wie diese werden auch in der Ratgebervorlage für strukturiertes Skriptschreiben detailliert beschrieben, um sicherzustellen, dass der narrative Bogen von Anfang bis Ende trägt.
Timing: Warum Sekunden zählen
Wer ein Skript schreibt, denkt in Worten. Wer einen Film produziert, denkt in Sekunden. Die Übersetzung ist nicht trivial. Ein Satz kann geschrieben kurz sein, gesprochen aber Zeit brauchen – wegen Betonung, Pausen, Rhythmus. Deshalb: Stoppe dein Skript. Lies es laut, nimm es auf, höre es ab. Wenn das Skript bei 220 Wörtern liegt, aber 100 Sekunden dauert, ist es zu lang. Kürzen heißt nicht, Inhalte zu streichen, sondern Ballast zu eliminieren. Adjektive, Füllsätze, Höflichkeitsfloskeln. Was bleibt, ist die Essenz. Und die reicht meistens.
Von der Theorie zur Umsetzung
Ein Skript ist kein Selbstzweck. Es ist die Blaupause für Bild, Ton und Schnitt. Deshalb sollte es nicht nur inhaltlich funktionieren, sondern auch praktisch nutzbar sein. Das bedeutet: Spaltenformat. Links der Sprechertext, rechts die Bildideen. Szene für Szene. Zeile für Zeile. So sehen alle Beteiligten – vom Illustrator über den Sprecher bis zum Cutter – sofort, was wo passiert. Wer allein arbeitet, profitiert ebenfalls von dieser Struktur. Sie zwingt dazu, visuell zu denken. Und sie macht sichtbar, wo Lücken klaffen – Stellen, an denen die Sprache etwas behauptet, das Bild aber nicht zeigt. Die Frage, ob ein Erklärfilm intern umgesetzt oder extern produziert werden sollte, hängt oft davon ab, wie präzise diese Vorlage bereits ist.
Der finale Check: Was bleibt hängen?
Bevor ein Skript in Produktion geht, braucht es einen letzten Realitätstest. Nicht: „Ist alles gesagt?" Sondern: „Was bleibt hängen?" Ein gutes Skript transportiert eine zentrale Botschaft, die nach 90 Sekunden im Kopf bleibt. Alles andere ist Kontext. Wer unsicher ist, lässt das Skript von jemandem lesen, der das Thema nicht kennt. Die Frage danach: „Was ist die Kernaussage?" Wenn die Antwort diffus ausfällt, fehlt Fokus. Wenn sie klar kommt, funktioniert das Skript. Dieser Test ist brutal ehrlich – und unverzichtbar.
Das Skript als Prozess, nicht als Produkt
Niemand schreibt ein perfektes Skript im ersten Anlauf. Auch nicht im zweiten. Skriptentwicklung ist iterativ. Entwurf, Feedback, Überarbeitung. Wieder und wieder. Was nach der ersten Fassung elegant klingt, wirkt in der dritten Version oft überladen. Was anfangs zu knapp erschien, entfaltet sich später. Diese Offenheit für Veränderung ist keine Schwäche, sondern Methode. Ein Skript wächst durch Reduktion. Durch Weglassen. Durch die Bereitschaft, ganze Passagen zu streichen, die zwar gut, aber nicht notwendig sind. Das ist der härteste Teil des Prozesses – und der wichtigste.
Ein Skript für einen Erklärfilm ist keine literarische Übung. Es ist ein Werkzeug, das Klarheit schafft – für die Zielgruppe, für das Team, für das Projekt. Wer versteht, dass jedes Wort zählt, jede Sekunde Bedeutung trägt und jede Szene ein visuelles Versprechen einlöst, hat die Grundlage gelegt. Der Rest ist Handwerk. Und das lässt sich lernen.